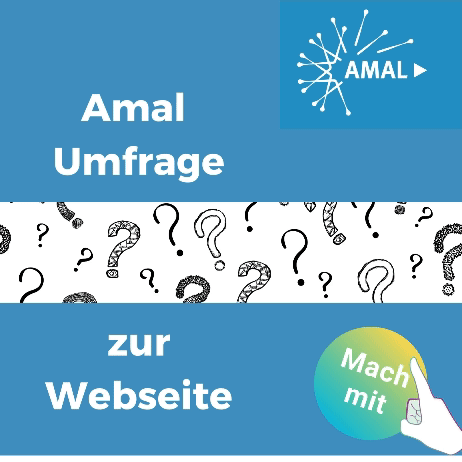Der Begriff Heimat hat für mich zwei Seiten. Die eine hat mit dem Iran zu tun. Die andere mit Deutschland.
Zum einen ist Heimat für mich verbunden mit dem Ort, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Manchmal sehe ich ein Bild von dort, und bin sofort in einer andren Welt, bei den Menschen, mit denen ich dort gelebt habe, und den Dingen, die dich dort erlebt habe. Ich vermisse diese Heimat. Ich wurde gezwungen, sie zu verlassen. Ich bin nicht freiwillig gegangen.
Ich werde nostalgisch, wenn ich in diesem Kontext an diese Heimat denke. Aber ich denke dann nicht politisch. Dass ich mich für den Iran engagiere, für die Menschen, die dort leben, ist unabhängig von diesen Gefühlen. Ich tue es nicht, weil ich die Iraner mehr liebe als die Norweger. Sondern schlicht, weil ich mich in Bezug auf den Iran besser auskenne. Ich engagiere mich, weil ich es kann – und weil ich möchte, dass der Iran ein besseres Land wird.
Hier in Deutschland hat der Begriff Heimat für mich eine andere Bedeutung. Hier ist er verbunden mit der Debatte, die hier derzeit geführt wird. Dazu mache ich mir politische Gedanken und auch Sorgen. Diese Debatte hat mit Ausgrenzung zu tun. Sie hat mit uns zu tun.
In dieser Debatte geht es um den Konflikt zwischen den sogenannten Einheimischen, die dieses Land als Heimat definieren, und denjenigen, die irgendwann und irgendwie eingewandert sind. Dabei ist unwichtig, ob diese Einwanderer das Land für sich als Heimat definieren. Viele fühlen sich hier zu Hause, viele sind hier geboren und kennen gar kein anderes Land. Manche sind schon in der dritten Generation hier. Aber auch das zählt nicht. In diesem Konflikt verläuft die Linie zwischen den Weißen, man könnte auch sagen den Biodeutschen – und den Nicht-Weißen. Die Einheimischen, die ihre Vorfahren hier haben, grenzen die anderen aus – und dafür benutzen sie den Begriff Heimat.
Ich erinnere mich noch gut an meine erste Demonstration in Deutschland. Es war Anfang 2015, ich war gerade angekommen. Ein Freund nahm mich mit zu einer Anti-Pegida-Demo. Da waren vielleicht 60 Pegida-Anhänger und 1.000 Gegendemonstranten. Ich verstand wenig von ihren Forderungen. Aber einer ihrer Slogans hieß „Nationalismus raus aus den Köpfen!“ „Whouuuwh“, dachte ich.
Das war ein echter Schlüsselmoment. Ich hatte, bevor ich nach Deutschland kam, im Irak gelebt. Ich hatte erlebt, wie die Kurden dort ihre Nation und ihre Heimat verteidigen – gegen den IS und auch gegen Bagdad. In jener Zeit ging es dort zum ersten Mal um eine Referendum für einen unabhängigen kurdischen Staat. Ich hatte darüber berichtet und mit etlichen kurdischen Intellektuellen gesprochen. Es ging darum, die Heimat vom IS zu befreien. Der Begriff Heimat war positiv besetzt, Nationalismus wurde von den progressiven Kräften propagiert.
So ähnlich kannte ich es auch aus dem Iran. Dort sagen viele Oppositionelle: Das islamische Regime hat das Land besetzt, wir wollen unser Land befreien. Das ist ein richtig beliebter Gedanke gegen das Regime. Die erste politische Bewegung im Iran, die dazu führte, dass das Land 1906 sein erstes Parlament bekam, nannte sich die Nationalisten oder die Patrioten, und das war progressiv besetzt. Viel später, in der grünen Revolution, an der ich dann selber beteiligt war, gab es die Parole: „Wir holen uns die Flagge des Iran zurück!“ Auch da war der Nationalismus positiv besetzt. Und nun erlebte ich, wie in Deutschland die progressiven Kräfte riefen: „Nationalismus raus aus den Köpfen.“ Whouwh.
Was ich sagen will: Der Begriff Heimat ist immer in dem Kontext zu sehen, in dem er gebraucht wird. Und so, wie er in Deutschland derzeit gebraucht wird – nämlich zur Ausgrenzung – ist er gefährlich.
Dabei könnte man den Begriff auch anders verwenden. Die Heimatler – also jene, die sich für ihre Heimat stark machen und sie verbessern wollen – könnten sich darum bemühen, dieses Land auch für die anderen zur Heimat zu machen, also zu einem Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen. Sie könnten sagen: Wir wollen nicht, dass die anderen sich hier fremd fühlen. Ja, das könnten sie tun.
Die Texte entstanden als Kooperation zwischen Amal, Hamburg, der Körber-Stiftung und dem Hamburger Abendblatt